 Das Wintersemester 2025/26 hat begonnen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben, die den Nebel der zahlreichen Nachrufe durchdringen und den umfangreichen Kern einer einzigartigen Musikerkarriere freizulegen versuchen.
Das Wintersemester 2025/26 hat begonnen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben, die den Nebel der zahlreichen Nachrufe durchdringen und den umfangreichen Kern einer einzigartigen Musikerkarriere freizulegen versuchen.
Keine leichte Aufgabe. Die Lösung versteckt sich hinter Aussagen, die eine Quelle, das Feuilleton, mancherorts nicht oben auf dem Hügel der Kompetenzen zeigen.
Mitunter möchte man auch Bezahlschranken einfach unten lassen:
„Mit seinem Saxofon rebellierte Klaus Doldinger im Nachkriegsdeutschland gegen die Vatergeneration, mit Soul und ´Gebrauchsmusiken´ wurde die Jazzlegende zum Brückenbauer.“ (Spiegel)
Die Zeit kommt dem Phänomen selbst mit Hilfe des Autobiografie-Co-Autors („Made in Germany – mein Leben für die Musik“, 2022) nicht näher.
Durch seine „offene Haltung“ (nämlich die Trennung in U- und E-Musik abzulehnen), „wurde Doldinger zu einem zentralen Vorkämpfer und Wegbereiter der deutschen Jazz-Revolution“.
Merkwürdig nur, dass der so Apostrophierte in einem entscheidenden definitorischen Moment, nämlich 1967 in der TV-Sendung „Free Jazz vs. Pop Jazz“, als er auf einen deutschen Jazz-Revolutionär traf, Peter Brötzmann, klar das andere Ende der Fahnenstange wählte und sich für eine kurzzeitige Veräppelung des Gegenüber sogleich selbst zur Ordnung rief.
Denn das war er in der Tat, „ein Mann von Herzenswärme und rheinischem Frohsinn“ (Zeit), er hatte Manieren. Er war ein Herr.
„…der vermutlich meistgespielte Jazzer der Welt.“ (Welt)
Dem zum Beispiel lohnte sich nachzugehen. Diese Aussage - wie sagt man heute? - zu skalieren.
Und die Lösung liegt nicht, dies vorweg, in der Verbreitung der Aufnahmen mit seinem Quartett in den 60ern (darin auch andernorts bewährte Kräfte wie Peter Trunk, b, und Cees See, dr), oder seinen beiden Jazzrock-Ensembles, dem kurzlebigen Motherhood und dem sehr langlebigen Passport. Auch nicht in „Doldinger in New York“ (1994, u.a. mit Victor Lewis, dr, und Tommy Flanagan, p).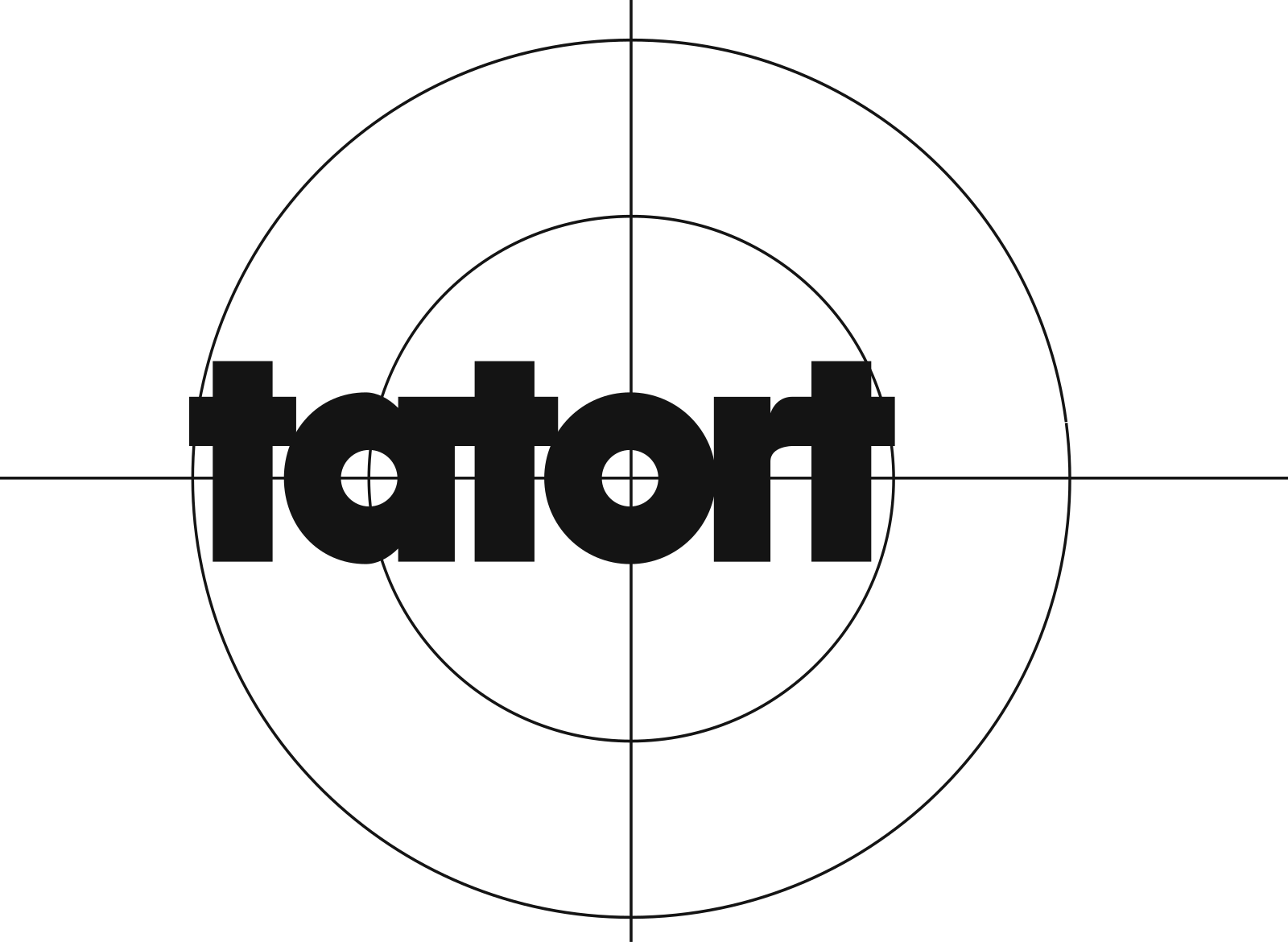 Die Quelle sprudelt (wenn wir großzügig US-Serien außer Acht lassen) in drei sequenzierten Quarten an beinahe einem jeden deutschen Fernsehsonntag um 20.15 Uhr, noch vor jeder Handlung, in den ersten 40 Sekunden, im Vorspann der Krimisererie „Tatort“; seit 1970, in bis dato 1.310 Folgen (zahllose Wiederholungen nicht eingerechnet. Die Folgen 1.311 bis 1.324 stehen an).
Die Quelle sprudelt (wenn wir großzügig US-Serien außer Acht lassen) in drei sequenzierten Quarten an beinahe einem jeden deutschen Fernsehsonntag um 20.15 Uhr, noch vor jeder Handlung, in den ersten 40 Sekunden, im Vorspann der Krimisererie „Tatort“; seit 1970, in bis dato 1.310 Folgen (zahllose Wiederholungen nicht eingerechnet. Die Folgen 1.311 bis 1.324 stehen an).
Das ist deutsche Folklore.
Die Zahl derer, die diese Musik kennen (oder diese Kenntnis mit ins Grab genommen haben), bewegt sich in einem dreistelligen Millionenbereich, ein Mehrfaches der gegenwärtigen Wohnbevölkerung.
Auch wenn der Eindruck sich nicht sofort entfalten mag - diese 40 Sekunden sind das Werk eines Jazzmusikers, im Netz finden sich hinreichend Analysen dazu. Es ist ein Stück mit starken Jazzrock-Anteilen.
Doldinger hat es 1970 komponiert. 1971 folgt - über den Vorspann hinaus - seine erste komplette Tatort-Musik (es ist die dritte Folge, „„Kressin und der tote Mann im Fleet“, Drehbuch: Wolfgang Menge). 2018 liefert er seine letzte Tatort-Musik („Bausünden“, Folge 1044).
In Sachen Funktionsmusik war er schon damals kein unbeschriebenes Blatt. Der Jingle zur Einführung des Farbfernsehens 1967 stammt von ihm, etliche Werbemusiken auch.
Eine große Tugend, die man Jazzmusikern nachrühmt, nämlich ihre große stilistische Adaptionsfähigkeit, Doldinger hat sie inside Jazz vollzogen (frühes Beispiel: im Jahr von Stan Getz/Charlie Byrd „Jazz Samba“, 1962, bringt das Doldinger Quartett die Single „Recado Bossa Nova/Copacabana“ heraus), er hat sie mit größten Erfolgen aber auch weit außerhalb des Jazz angewandt.
Abgesehen von frühen Dixieland-Tagen in Düsseldorf, wurzelt er in einem immer wieder neu anbaufähigen Hardbop, gesegnet mit einem großen Gespür für den Wechsel musikalischer Großwetterlagen. Als der Jazz elektrisch wird, setzt er Passport Anfang der 70er auf diese, in seinem Falle wiederum populäre Spur - Vergleiche mit Weather Report, wie sie auch heute wieder auftauchen, verdanken sich dabei allein der semantischen Doppeldeutigkeit der deutschen Sprache (es sind Vergleiche zwischen Äpfeln und Birnen. In der Sache sind sie geradezu frivol).
Und, ob er wirklich in das Triumvirat Mangelsdorff/Doldinger/Dauner gehört, wie es jetzt die FAZ insinuiert?
Doldinger war weniger Stilschöpfer als vielmehr ausgestattet mit lang ausgefahrenen Antennen für fremde Einflüsse. Er war ein begabter Verwerter, mit einem Händchen für eindrückliche Melodik, einem eigenen Formelvorrat (darunter Fanfarenhafte Momente), der sich quer durch sein gewaltiges Euvre zeigt, von seinem Jazzquartett in den 60ern bis in die zahlreichen großen Filmmusiken, „Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“, die zahlreichen TV-Serien.
In Düsseldorf hatte er Abitur gemacht, Klavier, Klarinette und Tontechnik studiert; letzteres dürfte ihm in den Studios, auch daheim in Icking, sehr geholfen haben.
Im Gegensatz zu anderen mit ähnlicher Karriere ließ ihn die Bühne nicht los, er hat sich durchgängig als Jazzmusiker verstanden. Und, in vielen Interviews unermüdlich die Ursünde unserer kleinen Welt (Kommerz = Ausverkauf) durch sein eigenes Beispiel aus der Welt zu modulieren versucht. Ganz typisch ein 3Sat-Interview von 2012 - es ist auch eine Selbstbeschreibung.
„Mein Geschmack ist relativ weitgefächert. Ich habe da keine großen Berührungsängste. Ich finde es wunderbar, wenn man einen konzertanten Auftritt hat, in dem man auch dem Jazz seinen gebührenden Anteil einräumen kann, aber dann auch übergeht in solche Geschichten wie Filmmusik. Und ich habe ja eine ganze Reihe von Sachen geschrieben, die in breites Publikum - Gottseidank! - erreicht haben. Da kann man jetzt auch die Nase rümpfen ´ah, der macht ja jetzt auch so kommerzielle Sachen!´ Damit habe ich kein Problem. Ich habe mir da keine Fesseln auferlegt. Ich habe auch Kinderlieder geschrieben. Es gibt eigentlich wenig Bereiche, denen ich mich verweigern würde. Ich finde es immer eine interessante Herausforderung, etwas Ungewöhnliches zu schreiben.“
Klaus Erich Dieter Doldinger, geboren am 12. Mai 1936 in Berlin, verstarb am 16. Oktober 2025 in Icking bei München. Er wurde 89 Jahre alt.
jazzcity Fragebogen mit Klaus Doldinger
Foto: Stephan Wirwalski (CC BY 3.0)
erstellt: 18.10.25
©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten
