Der Posten des Bassisten in Miles Davis´ frühem Jazzrock, man muss es wohl so sehen, war eine Zeitlang Produkt einer eher provisorischen Wahl.
Ron Carter, Bassist aus dem legendären zweiten Quintett, raspelte zuletzt auf der Baßgitarre auf "Filles de Kilimanjaro".
Dave Holland, von Miles von London nach New York gebeten, hatte seinen Studioeinstieg 1968 bei diesem Studio-Date, konnte sich aber mit diesem gattungs-notwendigen Instrument nicht recht (und auch später nicht überzeugend) anfreunden. Er verließ sich vorwiegend auf seinen Kontrabaß.
Bei „Bitches Brew“ wurde ihm eine Spontanbesetzung aus dem Nachbarstudio, nämlich der Columbia-Hausproduzent Harvey Brooks, zugesellt. Am E-Baß.
Nicht dass Holland seinen Job schlecht gemacht hätte, er wollte lediglich - wie und mit Chick Corea - "freiere" Stukturen anstreben und gründete mit letzterem das Quartett Circle.
Das Bass-Provisorium endete 1970 nach einem Konzertbesuch von Miles Davis bei Stevie Wonder und kulminierte in dem dieser Tage meist-kolportierten Satz:
„I’ll take your fucking bass player!“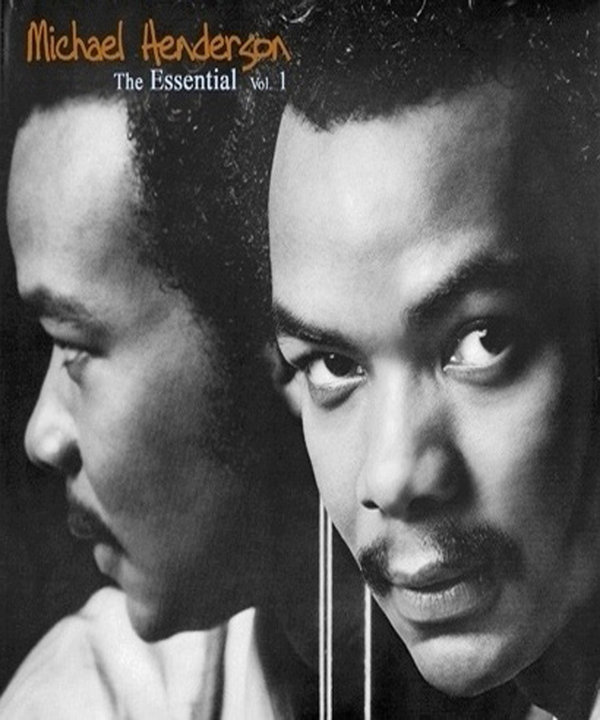 Miles „nahm sich“, wie die New York Times die Abwerbung schamhaft umschreibt, Michael Henderson.
Miles „nahm sich“, wie die New York Times die Abwerbung schamhaft umschreibt, Michael Henderson.
Und stellte mit ihm am 13.09.1970, so kann man es auch sehen, live seine neue Musik auf die Füße.
"Sein Talent, kreiselnde, reptetive Bass-Riffs zu spielen, gab der Musik von Miles sofort einen neuen Schwerpunkt" (Paul Tingen).
Die Band, in der wichtige Posten in schiefer, aber nicht gänzlich unpassender Metaphorik mit einem Studienplatz in der „Universität Miles Davis“ gleichgesetzt werden, hatte endlich auf dem rhythmisch exponiertesten Platz ihren Meister gefunden. Einen Funk-Meister.
Für den unter Strafe stand, das frühere Repertoire der Band sich anzueignen: "If you learn any of that old shit, you´re fired!" (Miles, zitiert nach Tingen*).
Man konnte den neuen touch schon im April 1970 hören: auf „Jack Johnson“, später auf „Live Evil“, „On the Corner“ und weiteren Alben bis 1975 - kürzelhafte Motive, ein bomben-sicheres timing, alle durften ausschweifen, Henderson war punktum da.
Mit furztrockenem Sound (Flageolett, vibrato & slap kamen erst später in Mode) in "granit-artigen bass-vamps, oft eine Viertelstunde lang auf einem einzigen Akkord" (*).
Wir erinnern uns, anno 1971, im Kölner „Sartory“, an den baumlangen Neuling, hohe Stirn, seltsam geteilter Oberlippenpflaum. Neben ihm ein weiterer Neuling, Ndugu Leon Chancler (in der Erinnerung mit einem extra-hohen ride-Becken, rechts), links wuselt Keith Jarrett (an der Orgel!), rechts der Saxophonist Gary Bartz.
Henderson steht wie eine Eins. Und spielt wie eine Eins. Was für ein Groove!
Dabei hatte er zu diesem Zeitpunkt keinerlei Jazzerfahrung. Aber fünf Jahre mit Stevie Wonder. Und Erfahrung als Motown-Studiobassist. Der Autodidakt war - natürlich - geschult am legendären Motown-Bassisten James Jamerson (1936-1983).
"Ich blieb nah an James' Sound, fing aber an, ab und zu meine eigenen Ideen einzubringen. Ich ging den Hals hinauf und fand höhere Noten“, notiert er in den liner notes seiner Compilation „Anthology“ (2018) .
Das war eine späte Rückschau auf die Jahre, von denen die Jazzwelt kaum noch Notiz genommen hat. Sein letztes Album erschien 1986.
Anders als George Duke, der dem Jazz in einem langen Gleitflug entschwebte, verschwand Henderson aus dem Jazz so rasch, wie er gekommen war.
Mitte der 70er, nach 6 Jahren Miles, mutierte er, durchaus nicht ohne Erfolg, als Sänger, Instrumentalist, Produzent. In den sanften Worten der New York Times: „Funk bassist turned Crooner“.
Obwohl, einmal noch gab er sich als Alumnus der Miles Davis-Universität zu erkennen, im Juli 2002, live im "Yoshis", in Oakland/Ca.
Zusammen mit den anderen Ex-Kommilitonen Ndugu Chancler, Barry Finnerty, Sonny Fortune, Badal Roy und Michael Wolff, keyb: „Children on the Corner“.
Eine „Rebirth“, wie der Anspruch des Albums lautet, war das nicht.
Michael Henderson, geboren am 7. Juli in Yazoo City/MS, erlag am 19. Juli 2022 in Atlanta/GA einer Krebserkrankung.
Er wurde 71 Jahre alt.
erstellt: 23.07.22, ergänzt und korrigiert: 25.07.22
©Michael Rüsenberg, 2022. Alle Rechte vorbehalten
* Zitate aus: Paul Tingen. Miles beyond. The Electric Explorations of Miles Davis, 1967-1991. Billboard Books, New York. 2001

 Nach einer Babypause, 1975, nahm dann er Platz bei ihr, bei Barbara Thompsons Paraphernalia und beide zusammen für lange Jahre im United Jazz + Rock Orchestra. Unvergesslich der Stolz der reihum ansagenden Herren, Soli ihrer blonden Saxophonistin absagen zu dürfen.
Nach einer Babypause, 1975, nahm dann er Platz bei ihr, bei Barbara Thompsons Paraphernalia und beide zusammen für lange Jahre im United Jazz + Rock Orchestra. Unvergesslich der Stolz der reihum ansagenden Herren, Soli ihrer blonden Saxophonistin absagen zu dürfen. Gestartet hatten sie ihr Unternehmen (neben den damals üblichen 20.000 DM, geborgt von Vater Winckelmann) mit dem szene-typischen Kapital aus Begeisterung und Engagement, als Fans.
Gestartet hatten sie ihr Unternehmen (neben den damals üblichen 20.000 DM, geborgt von Vater Winckelmann) mit dem szene-typischen Kapital aus Begeisterung und Engagement, als Fans. Es war in einem Wiener Kaffehaus, heute früh, wo uns die Nachricht durch einen Gast überbracht wird: Wolfgang Reisinger, einer der großen (soviel Pathos ist erlaubt), einer der großen Jazzsöhne der Stadt, ist tot.
Es war in einem Wiener Kaffehaus, heute früh, wo uns die Nachricht durch einen Gast überbracht wird: Wolfgang Reisinger, einer der großen (soviel Pathos ist erlaubt), einer der großen Jazzsöhne der Stadt, ist tot. Tatsächlich aber tritt in diesem Film eine Person von hinter dem Vorhang auf die (Film)Bühne.
Tatsächlich aber tritt in diesem Film eine Person von hinter dem Vorhang auf die (Film)Bühne. 
 Wer ihm begegnet ist, hält seine markanten Gesichtszüge in Erinnerung,
Wer ihm begegnet ist, hält seine markanten Gesichtszüge in Erinnerung, Am 1. Juni 1972 sitzt Badal Roy im Columbia Studio B:
Am 1. Juni 1972 sitzt Badal Roy im Columbia Studio B: Künstler des Jahres: Charlotte Greve
Künstler des Jahres: Charlotte Greve
 Aber, wie es sich lebt, in derselben Gattung neben einem solchen Giganten, die Bürde, der Zwiespalt, sie klingen unvermeidlich jetzt in den Nachrufen mit an. Beispielsweise in diesem FAZ-Satz über Emil:
Aber, wie es sich lebt, in derselben Gattung neben einem solchen Giganten, die Bürde, der Zwiespalt, sie klingen unvermeidlich jetzt in den Nachrufen mit an. Beispielsweise in diesem FAZ-Satz über Emil: 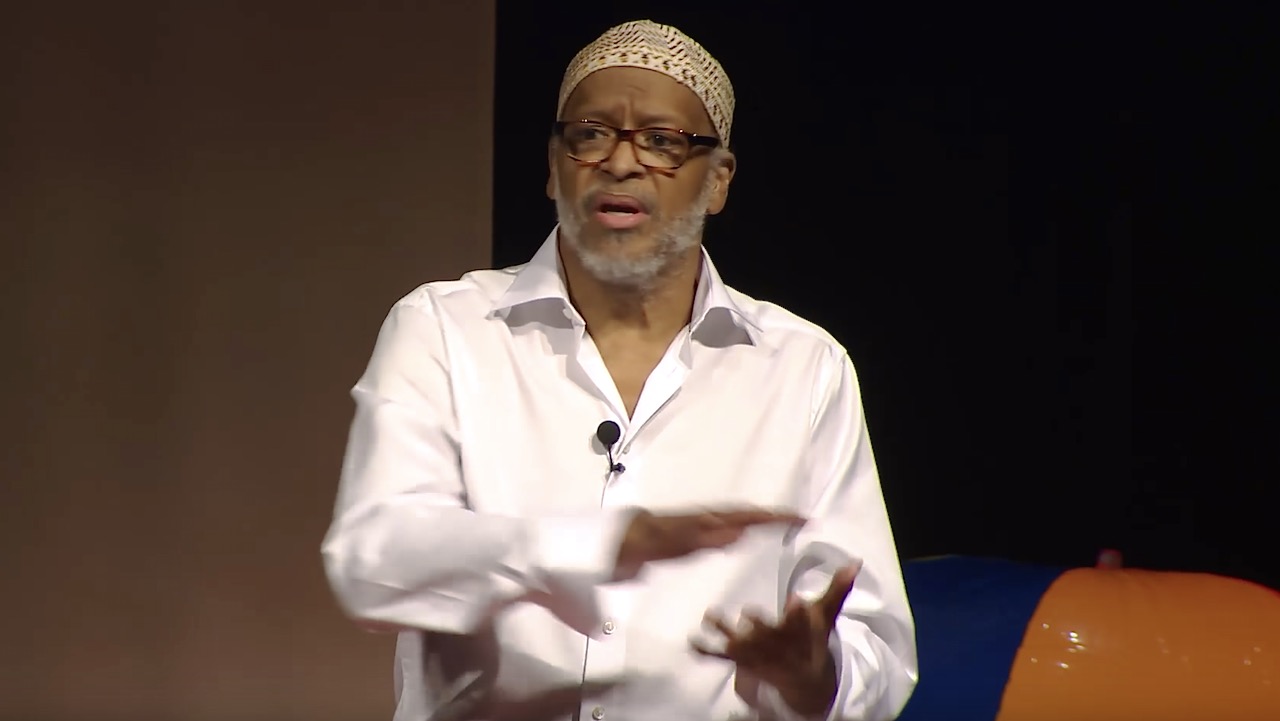 Dass in der New York Times der Pop- und nicht der Jazzkritiker den Nachruf schreibt, ist kein Zufall.
Dass in der New York Times der Pop- und nicht der Jazzkritiker den Nachruf schreibt, ist kein Zufall.