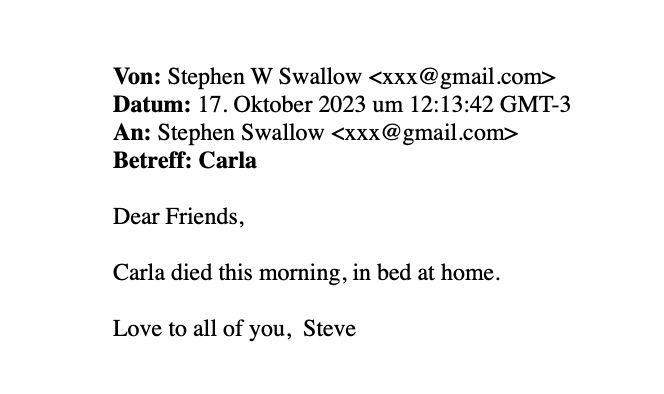
Im Spätsommer 2018 hatte die Nachricht bereits ein Vorecho; da war sie 82 und musste sich einer schweren Hirnoperation unterziehen. Eine Europa-Tournee wurde abgesagt.
Die Nachricht klang sehr beunruhigend, Nachrufe wurden erwogen; niemand hätte die Prognose gewagt, sie schon im Mai 2019 wieder auf deutschen Bühnen zu sehen (z.B. im Stadtgarten, Köln).
Die Konversion von Lovella May Borg in Carla Bley, in eine der bedeutendsten Autorinnen von Jazzstandards (auch jenseits ihres Geschlechtes), sprich KomponistInnen, ist ein Jazzmärchen der Extraklasse.
Und fast alle, die davon wissen, können auch den Prinzen benennen, der die Tochter eines Klavierlehrers aus Oakland/CA, die spätere Zigarettenverkäuferin im „Birdland“, New York City, ja sicherlich auch (wach)küsst.
Vor allem lockt er sie mit der Aufforderung in das neue Reich, „Ich brauche sechs neue Stücke für morgen!“
Richtig, das war der schreibfaule Pianist Paul Bley (1932–2016), in der Folge ab 1957 ihr Ehemann für zehn Jahre.
„Cigarette girl“, das klingt heute sowas von outdated und unterkomplex. Und tatsächlich war es für die junge Frau auch nur Mittel zum Zweck, die Jazzmusik am Ort ihres Entstehens einzuatmen. Denn als Paul Bley, der Pfeifenraucher, ihr ein Päckchen abkauft, war sie bestens vorbereitet. Mehr als alle anderen hatte sie im Birdland, im Basin Street und in der Jazz Gallery Count Basie (1904-1984) gehört:
„Er ist die letzte Instanz, wenn es darum geht, wie man zwei Noten spielt. Der Abstand und die Lautstärke zwischen zwei Noten ist immer perfekt.“
Es wäre übertrieben, die Schlichtheit ihres Klavierspiels auf Basie zurückzuführen (schon gar nicht verfügte sie über dessen timing), aber es liefert eine schöne Überleitung zu ihrer diesbezüglichen Selbsteinschätzung als „composer pianist“ (worin sie denn doch, bei ganz anderem output, viel eher Gil Evans ähnelt).
Zwar hat sie in ihren Veröffentlichungen immer auch Klavier gespielt, und vermehrt in den letzten beiden Jahrzehnten, eher kammermusikalisch im Trio (mit Andy Sheppard, ts) und immer mit ihrem dritten und längsten Lebens- und Musikpartner Steve Swallow (32 Jahre waren die beiden zusammen, ach was, das darf man wohl sagen, einander wirklich zugetan).
Ihren Platz in der Jazzgeschichte hat sie, siehe oben, als Komponistin.
Der britische Komponist (und gelegentliche) Bassist Gavin Bryars, der in den 80ern Stücke von ihr mit Freude in der Leicester Bley Band gespielt hat, schreibt dazu 1997 in einem Magazinbeitrag:
„Sie fühlt sich wohl mit Spielern, die begabte freie Improvisatoren sind. Es gibt viele Stücke, bei denen die scheinbare Schlampigkeit - in Wirklichkeit kalkuliertes Chaos - eine direkte Folge ihres kompositorischen Witzes und ihrer scharfen Beobachtung der Möglichkeiten für Exzess und Parodie ist.“
Ihre Stücke zu spielen sei „eine Herausforderung und zugleich eine der erfreulichsten Erfahrungen“ seines Lebens gewesen. Und Bryars vergisst nicht, auf „ihre Verwandtschaft zu gewissen Aspekten bei Kurt Weill“ hinzuweisen.
Ethan Iverson, der wohl hör-erfahrendste unter den heutigen Jazzpianisten, ist vor nicht langer Zeit im Gespräch mit ihr noch weiter zu den Kernen vorgedrungen.
Sie, die von Hause aus der Kirchenmusik kam, zählte sich nicht zum FreeJazz. Sie mochte vieler seiner Exponenten, wenn auch nicht ihr häufiges Herumlärmen, sie mochte darunter insbesondere den schwarzen Kirchenmann Albert Ayler:
„Maudlin! Rührselig auf die wunderbarste Weise. Er gab mir die Lizenz, etwas zu spielen, das wirklich kitschig war - und es zu lieben.“
Und wir als Hörer entnehmen daraus die Lizenz, dieses Motto auf vieles entlang ihrer langen Karriere zu beziehen; mitunter weniger Gelungenes, weil Langweiliges (insbesondere in den späten Trios mit Andy Sheppard), aber eben auch viel, viel Memorables, Bestgelungenes in sehr, sehr unterschiedlichen Formaten.
Das gilt natürlich für Paul Bley, früh auch für Gary Burton (A Genuine Tong Funeral“, 1968, worin auch „Sgt. Pepper“ hineingeflossen sein soll); dann ihre Großprojekte, das Jazz Composers Orchestra und „Escalator over the Hill“ mit ihrem zweiten Ehemann Michael Mantler. Hier lugt auch Charles Ives durch.
Dann die unzähligen Projekte mit ihrem kongenialen Partner und Bassisten Steve Swallow über mehr als drei Jahrzehnte.
Mitunter schien sie dabei dem Brecht´schen Motto zu folgen: „In mir habt Ihr eine, auf die könnt Ihr nicht zählen.“
Zum Beispiel Mitte der 80er, als sie mit drei Alben auf das Radioformat „Quiet Storm“ zielt („Sextet“, 1987, „Night Glo“, 1985, „Heavy Heart“, 1984) - ein, man scheut es auszusprechen, Schmusejazz-Format. Da waren einige doch leicht indigniert, unter ihnen ihr langjähriger Vermarkter Manfred Eicher.
Hier kommen wir aber mit Gavin Bryars überein: „Lawns“ von „Sextet“ ist „one of the most poetic of all Carla’s pieces“.
Eben. „Lawns“, das die Bittersüße ihrer Musik sowas von auf den Punkt bringt, mit einem dahingetupften Piano-Solo von Larry Willis (1942-2019) - und dann hoch-katapultiert von den Gitarrenschreien eines Hiram Bullock (1955-2008) zu „Healing Power“.
(Es läuft auch jetzt wieder).
Carla Bley, geboren als Lovella May Borg am 11. Mai 1936 in Oakland/CA, ist am 17. Oktober 2023 zu Hause in Willow/NY verstorben. Sie erlag einem Gehirntumor, der bei ihr 2018 diagnostiziert worden war. Sie wurde 87 Jahre alt.
PS: weiterführend links
Vinnie Sperrazza über die Schlagzeuger von Carla Bley
Der britische Pianist Liam Noble über Carla Bley
Carla Bley "Accomplishing Escalator over the Hill"
Carla Bley down beat-Interview 1978
erstellt: 17.10.23
©Michael Rüsenberg, 2023. Alle Rechte vorbehalten
 Man könnte, in einer ersten Annäherung, ihn für den Ron Carter des europäischen Jazz halten.
Man könnte, in einer ersten Annäherung, ihn für den Ron Carter des europäischen Jazz halten. 
 Licks like Sanborn, näselnd im Ton, häufig mit starker Blues-Inflektion, fast immer perfekt durchphrasiert, in Verwandtschft zu Hank Crawford (1934-2009), eine akustische Ikone:
Licks like Sanborn, näselnd im Ton, häufig mit starker Blues-Inflektion, fast immer perfekt durchphrasiert, in Verwandtschft zu Hank Crawford (1934-2009), eine akustische Ikone:  Der andere Star unter den 16 auf der der Bühne (das Festival wirbt so mit beiden) ist der Ruhrtriennale-Chef der Jahre 2012-2014:
Der andere Star unter den 16 auf der der Bühne (das Festival wirbt so mit beiden) ist der Ruhrtriennale-Chef der Jahre 2012-2014: 

 Für einen Jazz Poll wäre er wohl nicht in Frage gekommen. Dafür bewegte er sich zu sehr im off, im benachbarten
Für einen Jazz Poll wäre er wohl nicht in Frage gekommen. Dafür bewegte er sich zu sehr im off, im benachbarten 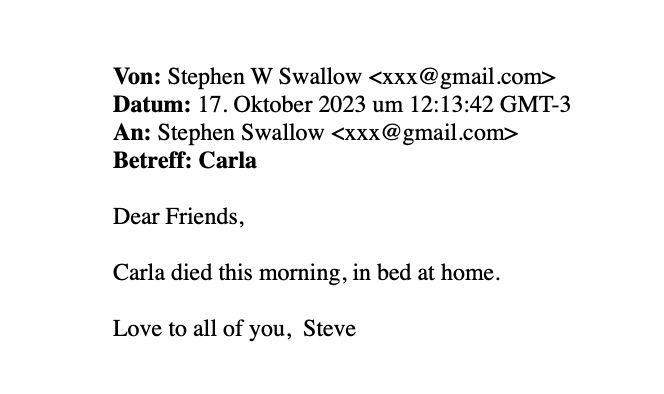
 Dass die Nachrufe auf ihn nun überschrieben sind mit „keyboardist for Steely Dan dies aged 63“ (Guardian) kommt nicht von ungefähr.
Dass die Nachrufe auf ihn nun überschrieben sind mit „keyboardist for Steely Dan dies aged 63“ (Guardian) kommt nicht von ungefähr. In den letzten Jahren hat er viel für TV & Film komponiert.
In den letzten Jahren hat er viel für TV & Film komponiert. „…für die Entwicklung des straight ahead Jazz im Land von großer Bedeutung“,
„…für die Entwicklung des straight ahead Jazz im Land von großer Bedeutung“,  Sie folgt auf
Sie folgt auf  Bettina Bohle
Bettina Bohle

 London, Nähe Holland Park, ein Club,
London, Nähe Holland Park, ein Club,  In den letzten Jahren reiste er aus Viersen an, er lebte dort, seit 2000 mit einer Deutschen verheiratet, auf Anraten des Bassisten Ali Haurand (1943-2018), der ihm nicht unbedingt kongenialer Partner, aber für ihn erfolgreicher Organisator war.
In den letzten Jahren reiste er aus Viersen an, er lebte dort, seit 2000 mit einer Deutschen verheiratet, auf Anraten des Bassisten Ali Haurand (1943-2018), der ihm nicht unbedingt kongenialer Partner, aber für ihn erfolgreicher Organisator war.