Ästhetik des Jazz
Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
Josef Früchtl, Maria Moog-Grünewald (Hg)
Heft 59/1, Jg. 2014
Schwerpunktthema: Ästhetik des Jazz
Hamburg 2014: Felix Meiner Verlag
168 Seiten, 68 Euro
ISBN 978-3-7873-2712-6 ISSN 0044-2186
Hilfe, die Philosophen kommen!
Und die deutsche Jazz Community hat ihr Herannahen gar nicht bemerkt. Man sah sie nicht beim Jazzforum in Darmstadt oder an den sonstigen Diskursorten unserer kleinen Welt; dort führen mehr oder weniger Jazzkundige das Wort, Musikwissenschaftler, Ethnologen, Journalisten, Praktiker aller Art - aber eben nicht Philosophen.
Plötzlich sind sie da. 2014 ist ihr Jahr.
Daniel Martin Feige aus Berlin erzielte die größte Resonanz, mit seiner grundlegenden „Philosophie des Jazz“, voraufgegangen war Daniel Schmicking aus Mainz mit einem Fachaufsatz („Zur Phänomenologie interpersonellen Handelns und Bewusstseins. Eine exemplarische Analyse der Improvisation im Jazz“, in „Phänomenologische Forschungen“ 2013).
Und nun treten sie gar als Ensemble in Erscheinung, sieben an der Zahl, unter ihnen Jerrold Levinson, einer der bekanntesten amerikanischen Kunstphilosophen.
Einigen in unserer kleinen Welt war schon ein Feige zuviel, allen voran Spiegel Online, das bange fragte: „Wo bleibt Louis Armstrong?“ Und resigniert den Feige-Band in die Ecke warf: „Rezensenten, die offenbar alle Philosophie studiert haben, preisen das Werk“.
Die Welle, die wir nun sehen, hat einen exakt benennbaren Ursprung, eine Tagung an der FU Berlin im November 2012. Die meisten Beiträge von dort sind hier abgedruckt.
Nun kann man im Jazz über vieles Klage führen, ganz bestimmt auch über die Qualität seiner Diskurse; aber wer wollte, konnte sich hierzulande seit 1953, seit Berendt´s „Das Jazzbuch“, über den Gegenstand klug und dusselig lesen.
Das alles aber waren und sind mehr oder weniger Insider-Diskurse, in breiter Front Meinungen, Analysen, Thesen zu Detailfragen. Sie alle haben mit Leichtigkeit die Grundfrage ignoriert oder übersprungen:
ist Jazz eine künstlerisch wertvolle Musik? Und wenn ja, warum?
Das zu beantworten, ist Sache der Philosophen, eine Perspektive von außen. Sie kann nicht gelingen ohne Kenntnisse von innen, aber sie behandelt unser kleine Welt als eine von vielen, insbesondere im Hinblick auf die, in denen eine philosophische Debatte weiter fortgeschrittener ist als im Jazz (was dort nur für die englisch-sprachige Literatur behauptet werden kann).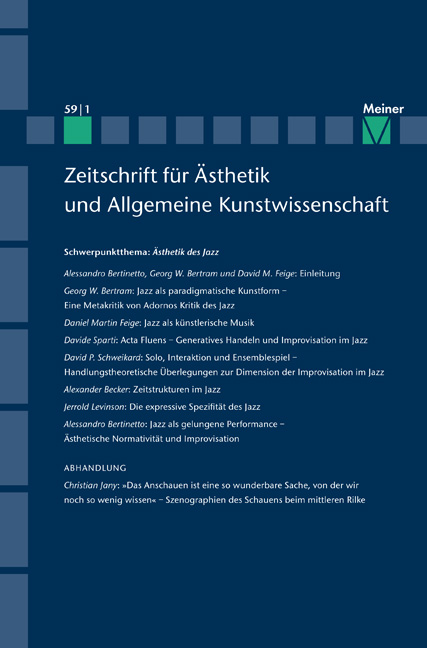 Zwar ist Jazz weithin als künstlerische Musik anerkannt, man muss nicht mehr - wie 1953 Joachim Ernst Berendt - als David gegen Goliath (seinerzeit Adorno) anrennen, aber gleichwohl ist Jazz „nicht hinreichend in Debatten der philosophischen Ästhetik und Kunsttheorie berücksichtigt worden“, wie es in der Einleitung zu diesem Band heisst.
Zwar ist Jazz weithin als künstlerische Musik anerkannt, man muss nicht mehr - wie 1953 Joachim Ernst Berendt - als David gegen Goliath (seinerzeit Adorno) anrennen, aber gleichwohl ist Jazz „nicht hinreichend in Debatten der philosophischen Ästhetik und Kunsttheorie berücksichtigt worden“, wie es in der Einleitung zu diesem Band heisst.
Das streben die Autoren an. Oder, wie es in den ersten Zeilen von Georg W. Bertram zur Adornos Kritik am Jazz heißt: „Es geht (...) nicht primär um die Frage, wie Jazz in seiner Spezifik zu begreifen ist, sondern um die Frage, was es heißt, Jazz als Kunst zu begreifen.“
Diese Perspektive ist erhellend, wir können davon profitieren - auch wenn wir uns manchmal vor dem gleissenden Licht der geschwollenen Sprache schützen, vulgo: Kritik üben müssen.
Das geht schon los mit dieser vollmundigen Ankündigung in der Einleitung: „Jazz könnte (...) auch als paradigmatische Exemplifikation von Freiheit und Normativität sowohl in der Konstitution und Transmission kultureller Traditionen als auch auf der Ebene der dialogischen und interaktiven Gestaltung des Verhältnisses von Individuum und Gruppe angesehen werden“.
Wird hier erneut, wenn auch viel gerissener, die alte Melodie vom Jazz als besonders demokratischer Kunst gepfiffen?
Mit Theodor W. gegen Adorno...
Der Band startet mit einem Thema, das viele meinen, längst ad acta gelegt haben zu dürfen: eine Auseinandersetzung mit Adorno´s Jazzthesen. Das könnte, folgt man Georg W. Bertram, verkürzt oder verfrüht sein; etwa mit dem nur scheinbar entlastenden Hinweis, Adorno habe ja nur Dixieland und Swing gemeint. Nein, Bertram weist in dessen Texten nach, dass Adorno zumindest von der Existenz des Bebop wusste.
Der Philosophieprofessor von der FU Berlin geht nun besonders raffiniert vor, er schürft tief, tiefer noch als Tobias Plebuch 2002 im „Merkur“:
„Ich gehe also, kurz gesagt, mit Adorno gegen ihn vor.“
Bertram zeigt, dass Adorno mit seiner Idee der „Formgesetze“ der Kunst ein zentrales Merkmal des Jazz übersieht/überhört: die Interaktion. Er äußert sich abfällig über den Tanz, Happenings und Performances bleiben im Sinne seines Formgesetzes „unzureichend“. Je mehr man mit Bertram in Adorno´s Gedankenwelt taucht - und je mehr man davon versteht, desto deutlicher wird, auf welch tönernen Füßen sie steht, auf welch höchst privaten Annahmen sie ruht.
Nicht nur in puncto Jazz hat Adorno sein eigenes Instrumentarium nicht richtig zur Anwendung gebracht.
Bis da hin ist das großes Erkenntniskino. Zum Schluß allerdings schlägt Bertram eine Volte: zunächst kritisiert er einen zentralen Satz von Daniel Martin Feige („Philosophie des Jazz“): „Gelingende Jazzperformances sind ästhetische Miniaturen einer gelingenden Lebensführung überhaupt“, um ihn dann abgeschwächt wieder einzuführen: „Die Jazz-Performance ist keine Miniatur, sondern ein mögliches Element gelingender Lebensführung.“ Was sollen wir denn davon halten?
Oder davon, „dass Rezipierende sich in der Auseinandersetzung mit einer Jazz-Performance als Subjekte zu verändern vermögen“?
Gilt das nicht für jedwede Musik?
Und...ist das nicht ziemlich banal?
Drei große I...
Unter dem Titel „Jazz als künstlerische Musik“ beleuchtet Daniel Martin Feige mehrere Teilaspekte seines Einzelbandes „Philosophie des Jazz“. Den von Bertram kritisierten Satz lässt er bestehen, relativiert ihn aber insoweit, als darin „nicht der spezifische Wert des Jazz als einer künstlerischen Musik gesehen werden“ sollte.
Den sieht der vielmehr in den drei großen I´s: „Mit Improvisation, Interaktion und Intensität sind (...) zwar keine drei Dimensionen benannt, die den Jazz trennscharf von anderen Arten künstlerischer Musik unterscheiden, wohl aber solche, die wesentliche Aspekte der Wertschätzung seiner Performances meinen“.
„Acta Fluens“ (schöner Titel) von Davide Sparti ist der erste von drei Beiträgen, die sich einem zentralen, wenn auch nicht hinreichenden Element des Jazz widmen, der Improvisation. Seine „zentrale Frage (...), wie Improvisation verstanden werden muss“ ist gespickt mit Musikerzitaten (allein von daher ist, wie auch in anderen Beiträgen, der Band eine Fundgrube).
Sparti´s Auffassung der Improvisation als einer „retrospektiven“ Tätigkeit wird von allen Autoren geteilt (die sich in manchem uneins sind), aber seine Behauptung, „man kann eine Improvisation nicht im Voraus vollständig ausarbeiten“, ist historisch unzutreffend.
Die Gegenbeispiele finden sich bei Andy Hamilton („Aesthetics & Music“, 2007):
„Die meisten Jazzmusiker bis hinein in die Swing-Ära der 1930er zeigten keinerlei Bedenken, ihre Soli zu üben und auszuarbeiten“ (S. 200). Demzufolge war Louis Armstrong einer der ersten, die in unserem heutigen Sinne improvisierten.
Ausgerechnet Andy Hamilton! Der „Wire“-Autor und Philosophiedozent in Durham/UK zählt - neben Ted Gioia - zu den Meistkritisierten in diesem Band. Beide sind Anhänger einer Imperfektionsästhetik, sie halten Jazz für „eine Kunst des Unvollkommenen“. Das ist nun kein negativer Wert, im Gegenteil, er speist sich in positiver Absetzung zu den Normen der Klassischen Musik.
Von der Imperfektionsthese halten die Autoren dieses Bandes rein gar nichts, und der virtuoseste Widerspruch kommt von Alessandro Bertinetto, der dabei der Frage, die alle anderen nur streifen („Gibt es Fehler im Jazz?“), in großer Ausführlichkeit nachgeht.
Auch hier wieder: tolle Musikerzitate, immer wieder gerne von Miles Davis, die nun philosophisch eingebettet in ganz eigenem Glanz erstrahlen. Bertinetto´s Resümee: „Fehler ist, was im Verlauf der Performance Fehler bleibt“. Denn eine Performance, hier eine Improvisation, besteht vor allem in der Chance, eigene Normen auszubilden und damit eine eigene Bewertung zu erzwingen.
Oder, in den Worten von Thelonious Monk: „Es gibt keine falsche Note. Es hängt allein davon ab, wie man sie auflöst.“
Bertinetto verweist auf ein YouTube-Video von Hans Groiner, wo dieser Monk „richtig“ spielt: es klingt falsch wie die Nacht, wie man früher im Ruhrgebiet zu sagen pflegte.
„Jazz lächelt, schleicht und verführt“...
„Jazz als gelungenen Performance. Ästhetische Normativität und Improvisation“ von Alessandro Bertinetto von der Universität Udine/I bietet Erkenntnisfrüchte sonderzahl, es ist der Höhepunkt des gesamten Bandes.
Wohingegen er auf den Seiten zuvor mit dem US-Starphilosophen Jerrold Levinson abstürzt. Das ist nun wirklich überraschend, denn der an der University of Maryland Lehrende gehört, neben Peter Kivy, zu den meist-zitierten Kunstphilosophen der Gegenwart.
Dass diese immer gut über ihren Gegenstand reden könnten, solange sie sich nicht auf Details einließen, ist ein oft gehörter Vorwand. Der hier per Paukenschlag bestätigt wird.
Levinson verhebt sich an einem Monster-Thema, nämlich der spezifischen Expressivität des Jazz, also welche „Emotionen, Stimmungen oder sonstigen mentalen Zustände“ kann Jazz zum Ausdruck bringen.
Und da hat Jazz gegenüber Klassik die schlechteren Karten: „Es scheint bestimmte Emotionen zu geben, die sich dagegen sträuben, im Idiom des Jazz (...) ausgedrückt zu werden.“ Trauer und Sorge z.B. hört er z.B. in Schostakowitsch´s 8. Streichquartett, im Trauermarsch aus Beethoven´s „Eroica“ oder auch im Adagio aus Mozart´s Klavierkonzert K 488 weitaus intensiver als im Jazz - „weil der klassischen Musik emotionale Bereiche zugänglich sind, von denen der Jazz weitgehend ausgeschlossen bleibt.“
Auch die Gamelan Musik hört sich für ihn gar nicht gut an: kann sie „Beängstigung, grüblerische Stimmung, Schrecken, Wut oder Pessimismus ausdrücken“?
Sodann gibt der Professor, die - wie er selbst einräumt - „karikaturhaften Charakterisierungen“ des Grundgefühls der fünf wesentlichen Genres an: Rockmusik - wie Bill Haley schon wusste - „schüttelt, wiegt und rollt“, der Jazz „lächelt, schleicht und verführt“.
Levinson´s Grundthese aber, nämlich „dass alle musikalischen Idiome in ihrer Expressivität begrenzt sind“, bedarf einer seriösen Antwort.
Nur kann diese nicht aus der Philosophie, sondern nur aus der Empirie kommen, vulgo: man müsste schon unter Hörern aus Bali ermitteln, ob in ihren Ohren/Gehirnen Gamelan-Musik „grüblerische Stimmung“ auszudrücken vermag.
In Levinson´s Beitrag tritt am deutlichsten ein Mangel zu Tage, der mehr oder weniger auch die anderen kennzeichnet: eine Ferne zu den Neurowissenschaften, zur Rezeptionsforschung, auch zur Musikethnologie.
Und, sollte man nicht Adorno verdient im Wiesengrund ruhen lassen, statt seinen für das Hören völlig untauglichen Denkfiguren nachzusteigen, ob der Jazz nun ein „autonomes Formgesetz“ habe oder nicht? Alexander Becker sieht auf Seite 85 Adornos´s Verdikt als „Vorwurf berechtigt“, was Georg W. Bertram zuvor feinsinnig widerlegt hatte.
Auf den Punkt gebracht: wenn in wenigen Wochen das zweibändige Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies, herausgegeben von George E. Lewis und Benjamin Piekut, auch in Druckform vorliegt, werden sich manche Gedanken in diesem Band als obsolet erweisen.
Dies ist gewiß ein sehr nicht-philosophisches Urteil.
Aber, stellen wir uns vor: Philosophen wie diese deutschsprachigen hier nebst ihren anglo-amerikanischen Kollegen brächten ihr Denken ein auf den Improvisationskonferenzen in Oxford, in Atlanta, sicher auch bei rhyhthm changes in Amsterdam und Salford, beim Jazzforum in Darmstadt sowieso (wo sie überall nahezu exklusiv fehlen) - wir kämen rasch ein gutes Stück weiter.
erstellt: 25.09.14
©Michael Rüsenberg, 2014. Alle Rechte vorbehalten
